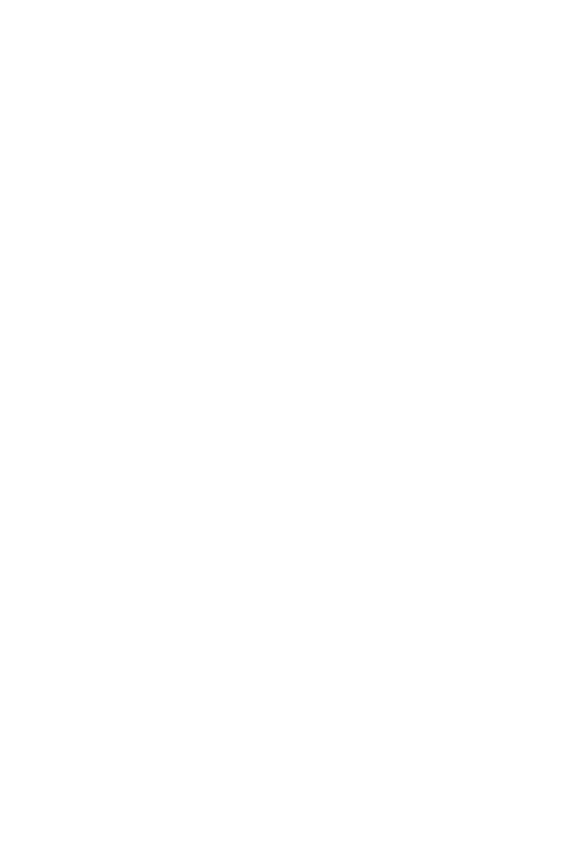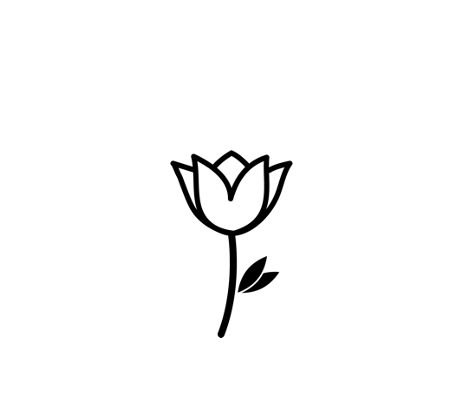
Die nächsten drei Tage vergingen im Flug: Morgens half ich Hugo bei seinen Arbeiten auf dem Hof. Nach der Siesta versuchte ich mich im Haushalt nützlich zu machen. Und abends kamen scharenweise Besucher vorbei, die mich aushorchten – teils subtil, teils weniger – wie es mich hierher verschlagen hatte.
Emilio, mein Begleiter bei der Ankunft, war jeden Abend da. Er rauchte am offenen Fenster und hörte den Gesprächen zu oder starrte in die Dämmerung. Der alte Schäfer mit dem kritischen Blick stellte sich als Hugos Vater heraus, der in einer Hütte am Waldrand wohnte. Er war der Einzige, dessen Spanisch ich nie verstand, aber seinem finsteren Blick nach zu urteilen war das vielleicht besser so. Generell ging das halbe Dorf bei Cecilia ein und aus, alle fühlten sich wohl in der kleinen Bauernstube, keiner ging trübselig nach Hause.
Hugo und Cecilia waren umsichtige Gastgeber: Er machte die Runde mit einer Flasche Kräuterschnaps, sie trug plattenweise Tapas auf. Er lachte über Witze, sie lauschte allen Sorgen. Wenn Cecilia mitbekam, wie ich mich unter den vielen Fragen zu winden anfing, rettete sie mich, indem sie meine Inquisitoren mit kleinen Aufgaben ablenkte. Gegen zehn schlich sie jeweils davon in die kleine Hütte beim Stall, von wo sie erst um Mitternacht zurückkehrte.
Im Gegensatz zu den Hofgästen fragten mich Hugo und Cecilia nie, warum ich eigentlich hier war, und wie meine weiteren Pläne aussahen. Es schien, als dürfte ich tatsächlich ewig bleiben. Das hätte ich auch gerne getan – der Alltag auf dem Hof war zwar körperlich anstrengend, aber seelisch entspannend. Meine Sorgen mit Lisa und der Beziehungspause waren in den Hintergrund gerückt und liessen mich bis am Morgen des vierten Tages in Ruhe. Dann klingelte beim Pfirsichpflücken mein Handy:
„Wo bist du denn die ganze Zeit?“, fragte Lisa. „Gehst du mir aus dem Weg?“
„Ich bin gerade in Spanien auf einem Bauernhof und pflücke Pfirsiche.“
„Wie? Verarschst du mich?“
Ich erklärte ihr, dass ich eine Freundin besuchte.
„Wieso habe ich von dieser Cecilia noch nie etwas gehört?“
„Na ja, ich weiss auch noch nicht lange von Sandy“, gab ich zurück. Lisa verstummte sofort, und mein Blutdruck schoss in die Höhe.
Wir fixierten unser erstes Dienstags-Date für in zehn Tagen. Das erste Treffen seit dem Auszug.
Abwesend half ich Hugo beim Verladen der Obstkisten, und als wir bereit waren zur Abfahrt, stellte er mir die erste und einzige Frage des gesamten Aufenthalts:
„Dieses Schweizer Wort, das du nach dem Telefonieren gesagt hast, was bedeutet das? Meine Frau hat das früher auch immer gesagt.“
„Welches Wort? Habe ich etwas gesagt?“
„Gof… goffer…“, sagte er unsicher, „…tami? Goffertami?“
Ich hätte gerne gelogen. Aber Hugo war jemand, den man nicht anlog, einfach, weil es sich nicht gehörte. Also erklärte ich ihm, dass das ein unanständiger Fluch sei, und entschuldigte mich auch gleich dafür.
„Cecilia wirkt auf mich nicht wie jemand, der flucht“, brüllte ich beim Losfahren über den Motorenlärm des Traktors hinweg.
„Sie war früher anders“, brüllte Hugo zurück. „Wild. Wütend.“
„Warum?“
Er zeigte zum Himmel. „Destino.“ Schicksal. Dann drückte er aufs Gas, um den Hügel hochzukommen. Der aufheulende Motor verbat weitere Nachfragen.
Im ratternden Rhythmus der Fahrt wurden meine Gedanken durcheinander gewirbelt. Sie starteten bei Lisa, wanderten aber schnell zur Grundfrage, die ich mir bei dieser Reise stellen wollte: Wie sähe mein fiktives Leben mit Cecilia aus, wenn wir damals zu einem Paar geworden wären? Würde ich auch mit ihr auf einem Hof leben und jeden Abend Gäste empfangen? Die Frage wirkte auf einmal lächerlich – ich wusste nichts über diese Frau. Zwischen dem kecken Mädchen von damals und der gütigen Gastgeberin von heute klaffte eine zu grosse Wissenslücke. Woher war Cecilias Wut gekommen? Wie hatte sie sie überwunden? Was war ihr mysteriöses Schicksal?
So, wie meine beiden Gastgeber mir keine Fragen stellten, so lief es auch in die Gegenrichtung: Wir diskutierten über Gott und die Welt, aber persönliche Fragen schienen tabu. Ich merkte jeweils schnell, wenn ich die Linie überschritt und Cecilia in höflichem Plauderton das Thema wechselte.
Ich konnte auf dem Hof der Monteros also nichts mehr über meine damalige Liebe lernen. Liebe mag zeitlos sein, aber sie hängt nicht lose in der Zeit. Sie ist gebunden an Orte, an Momente, an ein Geflecht von Gemeinsamkeiten und Gefühlen, das irgendwann zerreisst, wenn man es nicht pflegt. Meine damalige Schwärmerei liess sich nicht transplantieren vom Schulhof auf den Bauernhof, von einem unbeschwerten jungen Menschen auf einen, der 25 Jahre Erwachsensein mit sich rumschleppte.
Wir luden schweigend die Pfirsiche ab, und ich sagte zu Hugo, ich würde mich kurz in mein Zimmer zurückziehen. Dort buchte ich einen Flug für den nächsten Nachmittag, packte schon mal einige Sachen und streckte mich auf dem Bett aus.
Ein kleines Teufelchen flüsterte in mein Ohr, so könne die Reise nicht zu Ende gehen. Ich sei doch nicht mehr der schüchterne 15-jährige von damals. Ich sei feige, wenn ich jetzt ginge – oder wäre ich nur hierher gekommen, um vor Lisa, Sandy und vor allem mir selbst zu fliehen? Am letzten Abend müsse noch irgendeine grössere Erkenntnis zu gewinnen sein, als ‚Liebe lässt sich nicht transplantieren‘. Ich könnte Cecilia doch trotzdem auf meine damalige Schwärmerei ansprechen, oder auf ihr dunkles Schicksal, oder wenigstens auf diese wilde, wütende Phase, die Hugo angedeutet hatte. Es sei vermutlich ohnehin das letzte Mal, dass ich sie in diesem Leben sehe.
Insbesondere wollte das Teufelchen aber wissen, was in der kleinen Hütte geschah, die Cecilia jeden Abend aufsuchte.
Lies weiter
Der Button bringt dich zurück zur Startseite.
Lies zu Ende
Kaufe das Buch, wenn du sofort fertiglesen willst.